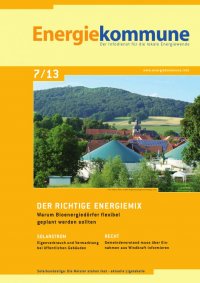
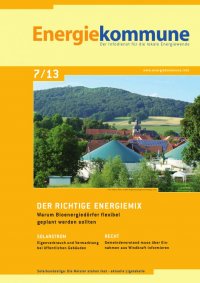
selbst verkaufen. Gelingt ihm beides nicht, so erhält er vom Netzbetreiber nur eine Minimalvergütung, die der- zeit bei etwa 4 Cent je Kilowattstunde liegen würde. Da bei Solarstromanla- gen bis 100 kW eine anderweitige Vermarktung des Stroms in der Re- gel nicht lohnt, bleibt den Genossen- schaften nur der Verkauf des Solar- stroms an die Gemeinde. Der faire Preis würde sich dann dort einpen- deln, wo die Gemeinde eine Erspar- nis erzielt und die Genossenschaft mit der Anlage ein positives Ergebnis erreichen kann. EEG-Umlage beachten Berücksichtigen muss die Genossen- schaft, dass bei Stromlieferungen an Dritte – und das wäre die Gemeinde, selbst wenn sie selbst Mitglied der Genossenschaft ist – die EEG-Umla- ge fällig wird. Sofern für die Liefe- rung kein öffentliches Stromnetz ge- nutzt werden muss, kann allerdings das im EEG geregelte solare Grün- stromprivileg in Anspruch genom- men werden; dadurch verringert sich die EEG-Umlage derzeit um 2 Cent je Kilowattstunde. Dies gilt nur, wenn es dem Übertragungsnetzbetreiber rechtzeitig, d.h. vor Beginn des vor- angegangenen Monats, mitgeteilt wurde. Es ist zu empfehlen, im Stromliefervertrag den Solarstrom- preis plus der jeweils gültigen Umla- ge zu vereinbaren. Die Genossenschaft muss zudem weitere Regelungen auch im Energie- wirtschaftsgesetz (EnWG) beachten. So ist dort recht genau vorgeschrie- ben, wie eine Rechnung an den Stromverbraucher ausgestaltet wer- den muss. Neben der 10-Prozent-Regelung sollte auch die 70-Prozent-Regelung in den Blick genommen werden. Die- se betrifft Solarstromanlagen bis 30 Kilowatt Leistung. Statt einer techni- schen Einrichtung, mit der der Netz- betreiber die Leistung der Anlage re- duzieren kann, kann bei solchen An- lagen die Maximalleistung generell auf 70 Prozent gedrosselt werden. Entscheidend ist, mit welcher Leis- tung das öffentliche Netz konfron- tiert wird. Beträgt die Maximalleis- tung der Module zum Beispiel 10 kW, so darf das Netz mit höchtens 7 kW belastet werden. Eine Möglich- keit besteht darin, die Wechselrichter kleiner auszulegen; dann geht aber Solarstrom verloren. Eine andere Op- tion ist es, im Gebäude die Leistung so- zusagen abzufangen. Das Potenzial der Solarstromanlage wird dann voll- stänig genutzt. Inzwischen gibt es auch entsprechende Geräte zur Steu- erung des Verbrauchs im Gebäude, die die externe Leistungabgabe be- grenzen. Anlagen pachten Neben der Stromlieferung existieren weitere Modelle, um Solarstrom vom eigenen Dach zu nutzen. So emp- fiehlt die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) das Pachten der Solarstromanlage. Hier würde ein Investor die Anlage errichten und an den Gebäudenutzer verpachten. Wichtig wäre dann allerdings, so er- klärt Rechtsanwältin Margarete von Oppen, dass der Strombezieher auch die Betriebsverantwortung für die Anlage übernimmt. Der Stromver- braucher müsste dann zwar nicht in- vestieren, aber alle anderen Aufgaben eines Anlagenbetreibers überneh- men. Vorteil der Konstruktion ist mo- mentan, dass dann die EEG-Umlage nicht fällig würde. Politik im Blick behalten Man sollte jedoch bedenken, dass re- lativ schnell neue politische Entschei- dungen einen solchen Vorteil erledi- gen könnten. Zu beachten ist auch, dass Betreibergemeinschaften, die eine Anlage nicht selbst betreiben, den Anforderungen des neuen Kapi- talanlagegesetzbuches gerecht wer- den müssen. Dies könnte das Pacht- modell oftmals unmöglich werden lassen. Keinesfalls sollte man sich von Solarstromprojekten abschrecken lassen. Die Anlagen- und Installa- tionskosten sind so deutlich gesun- ken, dass sich auch für Kommunen der Einsatz lohnen wird. Die Strom- erzeugungskosten liegen jetzt schon häufig unter den -bezugskosten und bleiben dabei über Jahrzehnte stabil. Es kommt nur darauf an, die jeweils günstigste Konstellation zu finden. AndreasWitt S O L A R S T R O M 7/ 2013Energiekommune 11 ZunehmendwirdvoneinzelnenEnergieversor- gungsunternehmen und Politikern problemati- siert,dassdieKostendesStromnetzesaufim- mer weniger Kilowattstunden umgelegt wer- denmüssten,weilStromverbraucher,dieihren Stromselbsterzeugen,andiesenKostennicht beteiligt seien. Dies wird als unfair bezeichnet und es wird mit der Forderung nach einer hö- heren Grundgebühr für die an das Stromnetz angeschlossenen Kunden verknüpft. DieswärewohlschonimmerfürNetzbetreiber eine attraktive Lösung gewesen, weil sie so mit festen Einnahmen rechnen könnten. Doch die Argumentation ist falsch. Zwar trifft es zu, dass der Betreiber einer Solarstromanlage we- niger Kilowattstunden aus dem Netz bezieht und damit auch weniger zur Finanzierung der Netzebeiträgt.Aberdiesgiltgenausofüralle,die mitmodernenKühlschränken,Fernsehern,Be- leuchtung oder Heizungspumpen Strom spa- ren. Wer PV-Anlagenbetreiber mit höheren Netzgrundkosten belasten möchte, müsste dies dann auch für Stromsparer fordern. Andreas Witt Eigenstromnutzer nicht diskriminieren an die Sonne