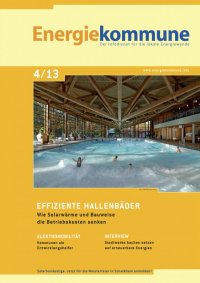
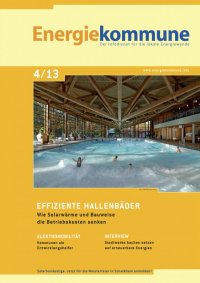
S O N N E N B Ä D E R 94/ 2013Energiekommune wegen der ganzjährig bereit zu hal- tenden Lufttemperatur von etwa 30 Grad Celsius können die Solargewin- ne auch im Sommer fast vollständig genutzt werden“, heißt es bei Gram- mer Solar. Allerdings ist die Rege- lung und Einbindung der Kollektor- anlage in die gesamte Gebäudetech- nik nicht trivial. Die Technik ist praxistauglich Bis zu 16 Paneele ließen sich bei Luft- kollektoren hintereinander schalten: „40 Meter lange Kollektorstränge sind machbar”, sagt Gerhard Troglau- er von Grammer Solar. Diese ermög- lichten pro Kollektorreihe einen Luft- volumenstrom von 660 bis 2000 Ku- bikmeter pro Stunde. Die thermische Nennleistung liege hier bei 670 Watt pro Quadratmeter. Wissenschaftliche Begleitunter- suchungen zu den solaren Hallenbä- dern sind jedoch rar. Weder am ISFH noch am Fraunhofer-Institut für Sola- re Energiesysteme (ISE) in Freiburg wird das Thema derzeit explizit bear- beitet – was man als Indiz dafür sehen könnte, dass diese Technik das Stadi- um der Forschung bereits überschrit- ten hat und in der Praxis angekom- men ist. Gleichwohl wird sie bislang nur selten eingesetzt. Bedauerlicherwei- se: Hallenschwimmbäder böten ein „vergleichsweise hohes Energie- und Kosteneinsparpotenzial“, schreibt die Energieagentur Nordrhein-Westfalen in ihrer aktuellen Broschüre „Ener- gieeffizienz in Schwimmbädern“. Riesiges Sparpotenzial Die Landeseinrichtung rechnet darin vor, dass sich durch optimierte Tech- nik 70 Prozent der Wärmeenergie einsparen lässt. Hinsichtlich der Ab- sorberfläche empfiehlt die Energie- agentur „als ersten Anhaltswert“ eine Fläche von 0,65 Quadratmeter je Quadratmeter Beckenfläche – ohne dabei allerdings zwischen Frei- und Hallenbädern zu unterscheiden. Neben den Solar-Hallenbädern gibt es inzwischen in Deutschland auch schon zwei Objekte, die als Pas- sivhaus konzipiert sind: die Bäder in Lünen und Bamberg. Wie bei jedem Passivhaus ist auch hier die Luftdich- tigkeit der Gebäudehülle definiert. Eine Halle in Passivbauweise darf eine Luftwechselrate von maximal 0,2 pro Stunde aufweisen – gegen- über 0,6 bei Wohnhäusern. Das heißt: Die Gebäudehülle des Hallen- bads muss so dicht sein, dass beim Blower-Door-Test bei einer Druckdif- ferenz von 50 Pascal nur 20 Prozent des Luftvolumens im Objekt pro Stunde ausgetauscht wird. Mehrinvestitionen rechnen sich Für das Lippe-Bad in Lünen mit 830 Quadratmeter Wasserfläche benen- nen die örtlichen Stadtwerke inzwi- schen erste Zahlen aus der Praxis: „Die jährlichen Einsparungen liegen etwa bei 210000 Euro“, sagt Jasmin Teuteberg, Sprecherin der Stadtwer- ke Lünen – verglichen mit einem konventionellen Bau nach Energie- einspar-Verordnung (EnEV). In die- sem Betrag seien auch Einsparungen bei Wasser und Abwasser enthalten. Die Mehrinvestitionen in Gebäu- dehülle und Haustechnik lagen ge- genüber dem EnEV-Standard bei rund 2,1 Millionen Euro, entspre- chend etwa 15 Prozent. Die Endener- gie-Verbrauchswerte lägen pro Qua- dratmeter Wasserfläche bei 1160 Ki- lowattstunden Wärme und 731 Kilowattstunden Strom. Solarther- mie sei hier jedoch „aufgrund der we- niger günstigen Wirtschaftlichkeits- bewertung“ nicht installiert worden, dafür aber rund 110 Kilowatt Photo- voltaik. Für die Dauer von zwei Jahren wird nun das Passivhaus Institut (PHI) in Darmstadt die beiden Pro- jekte Lünen und Bamberg auswer- ten. Denn ein Hallenbad ist energe- tisch natürlich völlig anders zu be- trachten als ein Wohnhaus. Bei Hallenbädern, sagt Sören Pe- per, Wissenschaftler am PHI, gehe die meiste Energie durch die Ver- dunstung verloren, weshalb es sinnvoll sei, diese zu begrenzen. Und das ge- schehe sehr effizient durch eine Er- höhung der Luftfeuchtigkeit. Außer- halb der Badezeiten kann die Feuch- tigkeit sogar noch höher werden, sofern sichergestellt ist, dass keine Kondensation an feuchteempfindli- chen Bauteilen statt findet. Enorme Bedeutung erhält damit die Haustechnik. „In den beiden Hal- lenbädern hoffen wir auf eine Ener- gieeinsparung von 50 Prozent“, sagt Peper. Das Projekt in Lünen wurde von der Deutschen Bundesstiftung Um- welt (DBU) in der Planungsphase mit 125000 Euro unterstützt. Es sei ein „ökologisches Leuchtturmprojekt“, sagte Wulf Grimm, Abteilungsleiter Umwelttechnik der DBU, bei der Er- öffnung. Das Passivhaus-Bad solle „eine Initialzündung für weitere Bäder sein“. Bernward Janzing Foto:BarbaraFrey Hier schwimmt niemand mehr: Stillgelegtes Bad bei Oberstaufen im Allgäu. Wer sich auch in Zukunft ein Hallenbad leisten möchte, muss die Energiekosten in den Griff bekommen.